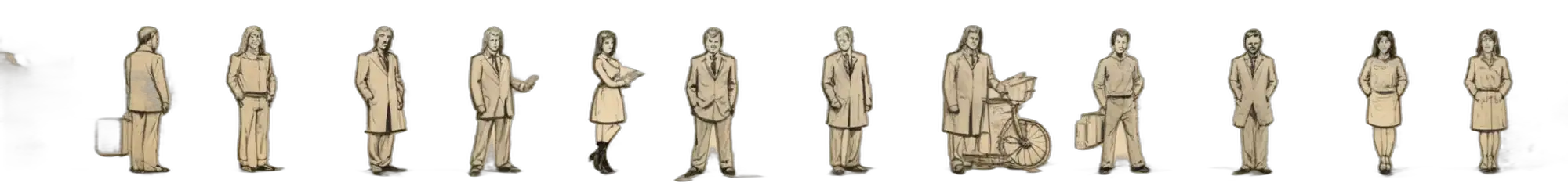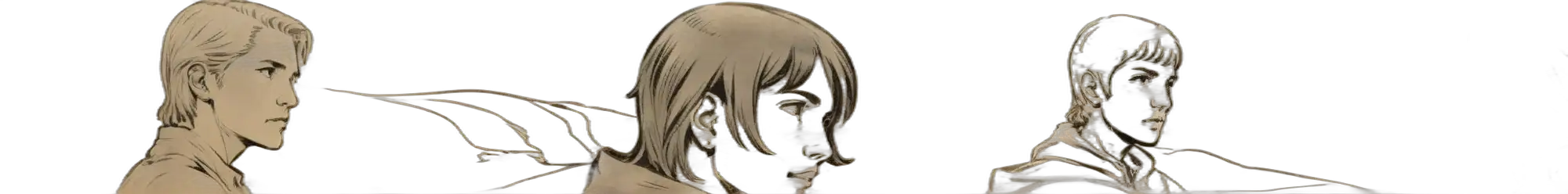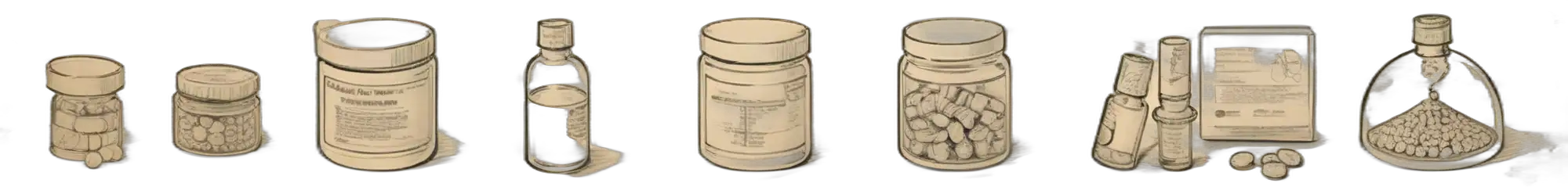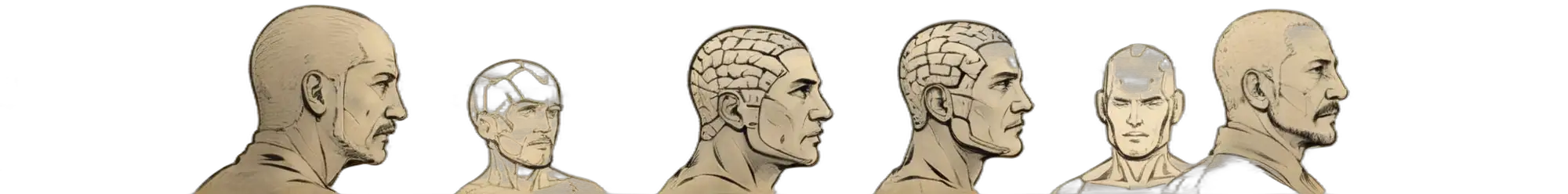Unterabschnitte von ADHS
Kindheit

Wie bereits in der Rubrik Über mich angedeutet, hatte ich als Kind starke Anzeichen von ADHS, was damals am ehesten als “Zappelphilipp” bezeichnet worden wäre. Weder der Kinderarzt noch andere Menschen, die mit diesen Auffälligkeiten hätten vertraut sein sollen (Erzieher*innen, Kindergärtner*innen, Lehrer*innen, …), haben dies bemerkt.
Es waren ganz typische Verhaltensweisen und Eigenarten, von denen ich hier nur einige aufzähle, um einen kurzen Überblick zu geben:
- Vergesslichkeit
- “Sprechdurchfall”
- sprunghafte Aufmerksamkeit
- Lange Konzentration nur bei Dingen, die mich brennend interessierten
- schlechtes Zeitempfinden
- Abgelenktheit in der Schule
- soziale Isolation in Kindergarten und Schule
- Unzuverlässigkeit
- Gedankengänge, denen schwer zu folgen war
- keinerlei Ordnungssinn
- permanenter hoher Bewegungsdrang und Probleme, dem nicht nachzugeben
Mich selbst und meine Familie hat das alles nicht wirklich belastet. Ich kannte es nicht anders und meine Familie akzeptierte, dass ich manchmal ein wenig wunderlich war. Die Tatsache, dass ich sehr schnell lernte, schnell für Dinge zu begeistern war (allerdings oft auch genauso schnell wieder das Interesse verlor) und keine Berührungsängste gegenüber anderen menschen hatte, hat wohl maßgeblich dazu beigetragen, dass mein Verhalten generell nicht als “abnormal” wahrgenommen wurde. Etwas eigen ja, aber nicht krankhaft.
Ich erinnere mich, dass ich mich in der Grund- und Hauptschule hauptsächlich gelangweilt habe. Meine Noten waren gut bis sehr gut, obwohl ich nach Meinung der Lehrer nie aufpasste. Ein Blick in die Zeugnisse, die ich zu Diagnosezwecken meinem Psychiater mitbrachte, bestätigte diese Erinnerung. Die Hausaufgaben hatte ich auch selten dabei, nicht, weil ich sie im engeren Sinne “vergessen” hätte - ich hatte einfach keine Lust darauf und habe sie so lange vor mir hergeschoben, bis es zu spät war und ich ins Bett musste. Während des Unterrichts war ich oft abgelenkt - ein Trecker auf dem Feld vor dem Klassenzimmer war oft interessanter als die Lehrer*in am Pult und den Rest der Zeit alberte ich leise mit den Klassenkamerad*innen herum.
Zu Hause gab es allerdings auch genug Dinge, die ich interessanter fand als die Hausaufgaben, die ja nur eine Wiederholung dessen waren, was man mir schon in der Schule erzählt hatte, also die reinste Zeitverschwendung waren. Aus meiner Sicht, wohlgemerkt. Warum etwas wiederholen, was man schon verstanden hat? Jedenfalls ging es nachmittags dann entweder an die Lego-Kiste oder an die Bücher, wenn die Abenteuer im Wald nicht noch interessanter waren. Eine lebhafte Phantasie hatte ich schon damals und wenn gerade nichts los war, malte ich mir im Kopf aus, ein Pirat zu sein, oder ein Feuerwehrmann, oder ein Affe, der auf Bäume klettert - das, was die meisten Kinder wohl auch tun würden. Gut, ich kannte kein Ende; wenn ich einmal in “meiner” Welt versunken war, vergaß ich alles um mich herum. Stundenlang auf einer Birke in 6 Metern Höhe hocken und zuweilen sogar dort oben einschlafen? Check. Lokführer mit der Gartenbahn spielen, bis es so dunkel war, dass meine Eltern mich vorsichtshalber reinholen mussten? Check. Mit Lego Phantasiebauwerke, Dungeons mit Falltüren oder komplexe Maschinen bauen, ohne auch nur daran zu denken, etwas zu essen oder zu trinken? Check. Und als irgendwann der C64 bei mir einzog, den meine Eltern mir schenkten (ich glaube, es war zu Weihnachten) war es aus und vorbei. Ich war acht oder neun Jahre alt und hatte nur noch Augen für die “Brotkiste”. Die Handvoll Spiele, die mir dazugelegt wurden, fesselten mich für ein paar Monate, bis ich das dicke Programmierhandbuch entdeckte. Mein Vater hat wohl einige Abende sehr bereut, mir das Gerät besorgt zu haben, denn er musste mir fortan die mir unverständlichen Begriffe in BASIC erklären und übersetzen, damit ich mir selber programmieren beibringen konnte.
Diese selektive Konzentrationsfähigkeit und das Eingraben in Themen, die gerade interessant sind, sind typisch für ADHS-Kinder. Das während des Spielens und Programmierens erforderliche Stillsitzen vor dem Gerät war für mich kein Problem. Zum einen sah es wohl für Außenstehende so aus, als würde ich den Joystick mit dem ganzen Körper bedienen statt mit einer Hand, so sehr ging ich bei jeder Bewegung mit (was im Übrigen beim Spielen mit dem Controller des NES bei Freunden genauso aussah). Zum anderen hing ich wohl schon als Kind mit Vorliebe in den verquersten Körperhaltungen auf dem Stuhl, mein Vater sprach von einem “Schluck Wasser in der Kurve”. Es sind viele kleine Erinnerungen an geflügelte Worte und Situationen, die mir heute helfen, meinen Zustand bis zur Kindheit zurückzuverfolgen und zu plausibilieren.
Jugend

Die echten Probleme gingen im Grunde erst los, als ich durch einen Umzug nach Schleswig-Holstein die Schule wechselte und mein winziger Freundeskreis plötzlich unerreichbar wurde. Ich war zwischenzeitlich auf die Realschule gewechselt, da das nächstgelegene Gymnasium, auf das ich gemessen an den Schulischen Leistungen hätte wechseln sollen, einfach zu weit weg war. Auch in der Realschule waren meine Leistungen gut, daher erschien es sinnvoll, mit dem Umzug den Wechsel ans Gymnasium zu wagen. Das muss ca. in der 6. Klasse gewesen sein.
Wir sind im Übrigen im Laufe meiner Jugend noch einige male umgezogen, vielleicht habe ich daher das “Wandergen” in mir. Lange hielt es mich bisher selten an einem Ort, ohne dass ich das Gefühl hatte, weiterziehen zu müssen. Aber das vorerst nur am Rande.
Cut zum Gymnasium. Meine ersten Tage dort waren schwierig, ich würde sogar sagen: Traumatisch. Ich kannte niemanden. Der Unterrichtsstoff der Gymnasialschüler war ein anderer als der, den ich aus der Realschule kannte, bzw. waren sie uns in einigen Bereichen einfach voraus. Ich hatte also das erste Mal im Leben einen Rückstand aufzuholen, für den ich weder verantwortlich war, noch die notwendigen Hilfsstellungen bekommen habe, um dies zu schaffen. Ich erinnere mich genau an eine Situation mit einer meiner Lehrerinnen zu dieser Zeit. Sie unterrichtete Englisch, was ich in Grundzügen zwar durch meine Programmiertätigkeiten lesen konnte, aber noch nie gesprochen oder bewusst gehört hatte. Heutzutage beginnt der Englischunterricht teils schon in der dritten Klasse, in den 80ern war das noch undenkbar. Ich, der Neue in der Klasse, hatte sowieso einen harten Stand. Die Klassenkamerad*innen fühlten mir auf den Zahn und loteten aus, wie viel ich mir gefallen lasse, während die Lehrer*innen mich teilweise am liebsten wieder auf die Realschule geschickt hätten. Weniger Arbeit, weniger Stress mit dem Nachzügler. Aber zurück zu der Lehrerin. Ich klebte förmlich an ihren Lippen, um ein Gefühl für die Sprache zu bekommen. Unbewusst muss ich stumm die Wörter nach- und mitgesprochen haben, denn an einem der ersten Tage des Unterrichts fuhr sie mich an, ich solle mich unterstehen, sie nachzuäffen. Was ich dummer Realschüler eigentlich am Gymnasium wolle, ich solle zu meinesgleichen gehen, da wäre ich besser aufgehoben. Der Wortlaut kann ich nicht zu 100% wörtlich wiedergeben, aber er war sehr nah an dem, was ich hier schreibe. Später hatte ich bei ihr noch Französisch, denk Dir den Rest…
Manche Lehrer*innen machten mir das Leben schwerer, manche unterstützten mich nach Kräften. Generell erinnere ich mich jedoch im Nachgang an keinen Tag, an dem ich gerne zur Schule gegangen wäre, seit ich auf das Gymnasium gewechselt war. Meine Mitschüler*innen trugen ihren Teil dazu bei, indem sie dem Begriff “Mobbing” eine neue Dimension gaben, die ich nicht kannte und mit der ich nicht umgehen konnte. Ich zog mich zurück, hatte als Klassenaußenseiter mit zwei weiteren Außenseitern (ebenso technikbegeisterte Nerds wie ich) Freundschaft geschlossen, aber die stetigen seelischen und körperlichen Angriffe forderten ihren Tribut. Zweimal Sitzenbleiben, Mitte der 11. Klasse lange Krankheit und danach freiwilliges Ausscheiden aus der Schule.
Was hat das Ganze nun mit ADHS zu tun?
Viele meiner Verhaltensweisen, die ich als Kind und bis zur Realschule noch ganz normal ausgelebt habe (Erinnerung: Für mich war das alles normal und ich wurde akzeptiert wie ich war), führten am Gymnasium zu Problemen. Fehlende Konzentrationsfähigkeit, Störung des Unterrichts durch ständiges Tuscheln (meine Klassenkamerad*innen hatten sehr schnell begriffen, wie schnell ich abzulenken und damit auch zu manipulieren war) und Hibbeln auf dem Stuhl und die bereits bekannten Probleme, die Hausaufgaben abzuliefern. All das wurde auf einmal nicht mehr akzeptiert oder mit guten Absichten getadelt, jedoch nicht nachverfolgt. Plötzlich wurde nahezu alles, was mich ausmachte, kritisiert und gegen mich verwendet. Ich unterstelle den Lehrern dabei nicht einmal böse Absichten; sie konnten mit einem ADHS-Kind einfach nichts anfangen, zudem sie von der Krankheit genausowenig etwas wissen konnten wie ich damals selbst. Das Ganze führte dazu, dass ich mich mehr und mehr zurückzog.
Irgendwann kam das Internet in Mode und wurde auch für Privatpersonen bezahlbar. Einen Optokoppler habe ich live nie gesehen, aber ein analoges Modem blockierte eines Tages die Telefonleitung meiner Familie. Ich frickelte mich durch das entstehende Internet, lernte, probierte aus. Stundenlang. Ich erinnere mich, wie ich mit roten Ohren meinen ersten E-Mail Account erstellte, immer in der Erwartung, dass jetzt irgend etwas schlimmes passieren kann, eine hohe Rechnung oder andere Dinge. Meine erste Homepage. Und dann: Chaträume! EIner der damals größten Anbieter hatte es mir angetan, denn es gab einen Chatraum für Rollenspiele. Ich hatte zwischenzeitlich mit meinen Nerd-Kumpels eine DSA-Runde gestartet und Gefallen an den dynamischen Kopfwelten und dem Würfelglück gefunden, und so fiel es mir nicht schwer, mich in das Chat-Rollenspiel in all seinen Facetten zu verlieren. Und plötzlich war ich Teil einer Community. Leute, mit denen ich frei reden konnte. Leute, die zwar auch manchmal etwas komisch waren, aber mich akzeptierten. Leute, die komische Klamotten trugen und noch komischere Musik hörten. Mein Einstieg in die Gothic-Szene, die mich viele Jahre begleiten sollte und bis heute einen Platz in meinem Herzen hat.
Wir klatschten, tratschten, telefonierten und trafen uns alle paar Monate irgendwo in Deutschland. Die anderen waren genauso seltsam, schräg und spannend wie ich sie mir im Chat vorgestellt hatte. Eine wilde Mischung aus großartigen Menschen und zerbrochenen Existenzen. Und ich mittendrin, auf allen Ebenen. Und rückblickend mit Sicherheit die eine oder andere Leidensgenossen mit undiagnostiziertem ADHS. Das fiel aber bei den ganzen seelischen Schieflagen, die sich in dieser Community offenbarten, auch nicht weiter auf. Ich integrierte mich, stellte für meine Mitstreiter Online-Services bereit (es war die Zeit der Foren, an Facebook, Google & Co. war noch nicht zu denken) und tat alles, um die Gunst der Stunde nicht zu verlieren. An anderer Stelle hatte ich genug zu kämpfen und kompensierte das auf diesem Weg.
Als das Schulleben Anfang 20 (remember: Zweimal sitzen geblieben und tatsächlich schon im Kindergarten ein Extrajahr angehängt wegen “sozialen Anpassungsschwierigkeiten”) für mich zu Ende war, suchte ich mir einen Job, fing eine Ausbildung an, lachte mir meine erste Freundin an, beendete die Ausbildung nach wenigen Monaten, wurde im Ausbildungsbetrieb als unausgebildeter Hauptadministrator fest angestellt und hielt mich irgendwie über Wasser. Emotional ging es jedoch bergab, meine Beziehung zu meinem Vater wurde immer schlechter und ich packte schließlich meine Siebensachen und zog weit, weit weg nach Essen.
Erwachsenenalter
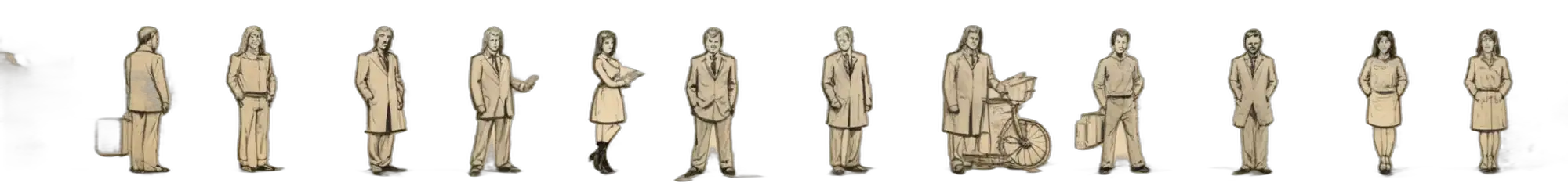
Essen - warum ausgerechnet Essen? Ich glaube, das ist die eine Frage, die ich mir in den folgenden drei Jahren am meisten gestellt haben dürfte. Dabei ist die Antwort ganz einfach: Kurzschluss-Reaktion.
Einige Monate nachdem ich meine Ausbildung abgebrochen und den Job als Administrator angenommen hatte, geschahen Dinge, die die Firma in den Konkurs trieben. Mein Leben, das durch verschiedene Umstände reichlich aus den Fugen geraten war und das durch den Job und die damit verbundene Sicherheit etwas stabilisiert wurde, stand plötzlich wieder auf wackligen Beinen. Die sich zuspitzenden Konflikte mit meinem Vater zu Hause und ein Gefühl, nirgendwo richtig hinzupassen in der Gesellschaft führten dazu, dass ich nach Auswegen suchte. Und in dem Moment, als sich einer manifestierte, schlug ich zu. Ein Bekannter bot mir an, mit ihm eine WG zu gründen, zumindest so lange, bis ich wieder einen klaren Kopf haben würde und/oder selbst Fuß gefasst hätte. Ich sollte drei Jahre bei ihm leben.
Ich hatte in den Jahren davor gelernt, mit der Wut, die sich in den Gymnasiums-Jahren in mir angesammelt und sich nicht selten in Jähzorn-Ausbrüchen manifestiert hatte, umzugehen. Beziehungsweise ist “damit umgehen” vermutlich zu viel gesagt ist - ich schluckte sie herunter, ignorierte sie, zwang mich, alles äußerlich ruhig hinzunehmen ohne direkt zu explodieren. Gesünder wäre es vermutlich gewesen, die Wut nur zu verzögern, bis ich mich abreagieren konnte, ohne jemandem zu schaden. Die Erkenntnis kommt leider zu spät.
Auch gelernt hatte ich, dass meine Ängste und Unsicherheiten in Bezug auf andere Menschen und deren Akzeptanz am einfachsten für mich zu handhaben sind, indem ich versuche, mich jedem gegenüber so zu verhalten, wie ich glaubte, dass dieser es erwarten würde. Ich war nie ein unhöflicher Mensch, habe schon mein ganzes Leben lang Wert darauf gelegt, gewisse Umgangsformen einzuhalten, weil ich sie selber als angenehm und wünschenswert empfand. Jedoch hatte ich das Ganze ins Extrem getrieben und versuchte unterbewusst, jedem zu gefallen, um Enttäuschungen und Konflikten aus dem Weg zu gehen.
Man mag sich fragen, wieso. Ich kann es nur vermuten. Ich hatte schon immer Schwierigkeiten, das Verhalten von Menschen zu verstehen. Während Emotionen nahezu ungefiltert auf mich einprasselten (wenn jemand weinte, stiegen mir die Tränen in die Augen; wenn jemand wütend war, ballte ich die Fäuste; wenn Leute lachten und glücklich waren, war ich es auch), überforderten mich die komplett unverständlichen und unvorhersehbaren Reaktionen auf allen anderen Ebenen. Wieso verstanden andere oft nicht das, was ich sagte, sondern etwas, von dem sie glaubten, dass ich es meinte? Wieso sagten sie etwas, meinten aber etwas ganz anderes? Wann meinte jemand etwas ernst und wann scherzte er? Und warum wurde manches was ich sagte als unpassend empfunden, wenn es doch der Wahrheit entsprach? Die feinen Nuancen der menschlichen Kommunikation waren für mich immer eine Hürde. Dazu kam, dass ich mir nichts sehnlicher wünschte, als so spontan und wortgewandt zu sein wie viele andere. Antworten auf unerwartete Fragen, über die ich minutenlang nachdenken musste, kamen bei anderen wie aus der Pistole geschossen. Wenn ich das versuchte, redete ich nur unpassenden Unsinn.
All diese Unsicherheiten und Verständnisprobleme führten nach und nach dazu, dass ich Mechanismen entwickelte, um genau diese Schwächen auszugleichen und vor anderen zu verstecken, denn sie boten Angriffsoberfläche. Ich unterdrückte viele meiner Emotionen, denn damit konnte ich auch bedingt verhindern, dass ich die Emotionen anderer spiegelte und selbst viel stärker als meine eigenen fühlte. Ich ging alle möglichen (auch die unwahrscheinlichen) Abzweigungen von bevorstehenden Gesprächen im Kopf durch und fand schon im Voraus die passendsten Antworten auf die meisten davon. Teilweise lag ich nächtelang wach, weil in meinem Kopf innere Monologe und Dialoge möglicher Gesprächspfade in Dauerschleife abliefen. Das gab mir dann im Gespräch einen Anschein von Spontanität und Schlagfertigkeit und mir bescherte es ein wenig weniger Panik vor dem Kontakt mit Menschen. Die Verständnisprobleme bezüglich der Feinheiten der menschlichen Kommunikation bekam ich damit zwar leider nicht in den Griff, konnte aber auch da mit jedem Tag ein wenig mehr lernen, Situationen besser einzuschätzen und zu lernen, in welchem Kontext manche Dinge dies, in anderen Kontexten aber jenes bedeuteten. Ein unglaublich komplexes Gespinst aus wenn-dann-sonst-Verknüpfungen im Kopf, das permanent Aufmerksamkeit erfordert, aber mich halbwegs sicher durch den Tag navigiert.
Zurück nach Essen. Nach einigen Wochen, die ich brauchte, um überhaupt erstmal die neue Umgebung und den neuen Mitbewohner kennenzulernen und mich zu akklimatisieren, suchten wir gemeinsam neue Jobs. Er war langzeit-arbeitlos, Dauerkiffer und mindestens genauso unsortiert wie ich. Wir bewarben uns beide bei Medion als Hotline-Mitarbeiter: Ich wurde angenommen, er nicht. Bei ihm blieb es leider auch bei diesem einen Versuch, geregelte Einkünfte zu erzielen, in den folgenden Jahren war es meist ich, der den Kühlschrank füllte.
Der neue Job war spannend, aber stressig. Die Lernkurve war auf technischer Ebene nicht sonderlich steil für mich, denn mit Computern und Windows im Speziellen kannte ich mich hervorragend aus, oft besser als so manch alteingesessener Kollege. Aber wie man mit Kunden am Telefon umgeht, wie man ihnen die Informationen, die man braucht, um ihnen zu helfen, herankommt und nicht nur an die, von denen sie glauben, dass sie relevant sind, das wusste ich nicht. Dieser Teil der Lernkurve war steiler als alles, was ich bisher kannte. Ich lernte, Menschen zu verstehen; nicht das, was sie sagten, sondern das, was sie nicht sagten. Und das alles unter Zeitdruck. Wenn ab und zu mal ein Gespräch länger als 10 Minuten dauerte wurde das noch geduldet, wenn es täglich passierte wurde ermahnt, wenn es mehrfach am Tag passierte gab es ernste Gespräche. Und so lernte ich auch, schnell zum Punkt zu kommen, ohne meinem Gegenüber das Gefühl zu geben, dass er oder sie in der Schnellabfertigung gelandet ist. Alles Skills, die mir bis heute gute Dienste leisten. Und bei allem: Immer freundlich bleiben, egal wie wütend mein Gesprächspartner ist. Check. Hatte ich in den Jahren zuvor ja gelernt.
Der Stress, der mit der Beschäftigung in der Hotline kam, wäre vermutlich für mich nicht handhabbar gewesen, aber mir kam an dieser Stelle sehr zugute, dass mein Mitbewohner anfangs immer Cannabis im Haus hatte. Man mag darüber denken wie man will, aber um einen ruhigen Kopf zu bekommen, nachdem man einen stressigen Tag hatte, hilft es. Und so wurde auch ich nach kurzer Zeit zum regelmäßigen Kiffer. Anfangs nur ab und zu nach der Arbeit, dann jeden Abend, irgendwann rauchte ich auch vor der Arbeit zu Hause noch einen halben Joint, um ruhig und gelassen die Schicht zu beginnen. Ich war im Team auch nicht der einzige, der sich auf diese oder ähnliche Art das Arbeiten erleichterte. Mit der Zeit wurde zudem auch das Leben mit meinem Mitbewohner zunehmend zur Belastung, da er mehr und mehr die Kontrolle über sich, sein Leben und seine anger issues verlor, die ich selber ja bereits in den Griff bekommen hatte. Da half auch kein Kiffen mehr und als bei einem seiner Wutanfälle eines Tages mein Handy an der Wand zersplitterte zog ich die Reißleine. Ich zog für ein halbes Jahr zu einem Arbeiskollegen nach Bochum, kündigte kurz darauf und zog relativ spontan wieder in meinem Elternhaus ein.
Eine spannende Entwicklung, aber das sei hier nur am Rande erwähnt, ergab sich zwischen mir und meinem Vater, nachdem ich Jahre zuvor ausgezogen war. Unser Verhältnis besserte sich quasi über Nacht, die ganzen Reibereien, die wir hatten, waren vergessen und nicht mehr existent. Sie kamen auch nicht wieder, als ich wieder zu Hause einzog und den Keller in Beschlag nahm, den mein Vater eigentlich als sein Arbeitszimmer eingerichtet hatte.
Lange sollte das Wohnen bei der Familie auch nicht währen, ich verliebte mich und zog nach Bremen zu meiner Angebeteten. Dort hielt ich mich ein weiteres Jahr in einer Hotline über Wasser und begann dann meine erste ernsthafte Ausbildung als Fachinformatiker für Systemintegration - tatsächlich meine zweite Wahl, aber Anwendungsentwickler gab es offenbar schon genug. Die drei Ausbildungsjahre verliefen relativ ereignislos, in der Berufsschule lieferte ich gute Noten ab, langweilte mich zu Tode, hatte mit einigen Lehrern eine Art stumme Vereinbarung, dass ich nicht jede Fehlstunde eingetragen bekomme, solange meine Noten nicht absacken, und so verbrachte ich viel Zeit in der IT-Abteilung der Firma, teilte mein Wissen mit den anderen Auszubildenden, hielt die Infrastruktur am Laufen, setzte die Wünsche meiner Kollegen wenn möglich um und lernte allerlei über die internationale Vernetzung von Standorten, den Betrieb von SAP-Systemen und auch, wie man mit dem einen oder anderen Ausfall von Teilen der Infrastruktur umgeht. Ein kleiner Ausblick auf meine spätere Laufbahn im Incident Response? Vielleicht…
Die Beziehung endete, andere kamen und gingen und auch die Ausbildung ging irgendwann zu Ende. Ein 2er-Schnitt, nicht schlecht, hätte eine 1 überall sein können, wenn ich gelernt oder mich angestrengt hätte. Aber ich konnte mich nicht dazu durchringen. Dieses “mich zu etwas zwingen” war schon immer ein Problem, auf allen Ebenen. Schule, Beruf, Beziehung, Alltag. Dinge, die ich nicht als direkt sinnvoll oder zielführend erkannte, vernachlässigte ich. Aufgaben, die mir Spaß machten, waren dagegen eher Selbstläufer. Alles, was sich stumpf wiederholte war mein Todfeind, vermutlich auch einer der Gründe, warum ich selber rückblickend nicht sonderlich beziehungsfähig zu sein scheine und auch den Arbeitgeber recht regelmäßig nach 2-4 Jahren wechselte. Am Anfang ist alles spannend, aber nach Monaten bis Jahren stellt sich Routine ein. Und Routine vertrage ich nicht.
So auch mit der Ausbildungsfirma. Drei Jahre Ausbildung waren beendet und ich freute mich auf mehr Verantwortung und mehr Entscheidungsmöglichkeiten in der IT-Umgebung. Es kam anders, entgegen vorigen Absprachen bekam ich einen IT-Leiter vorgesetzt, mit dem ich weder menschlich noch fachlich auf einen Nenner kam und die Aufgaben blieben größtenteils dieselben. Dazu kamen nun auf Weisung des neuen Vorgesetzten viele strukturelle Vorgaben, die mir weder sinnvoll erschienen, noch in meine Arbeitsweise passten. Ich hatte aber auch gelernt, Dingen Zeit zu geben, da ich mich mit der Zeit an manches gewöhnen und anpassen konnte oder sich Situationen von alleine lösen. Und so blieb ich weitere drei Jahre in der IT, half meinen nachfolgenden Azubis, durch ihre Ausbildung zu kommen und versuchte, den IT-Leiter so gut es ging zu ertragen, zu ignorieren oder zu konfrontieren, wenn es ganz unerträglich wurde. Leider gab es diesbezüglich wenig Rückhalt seitens der Führungsebene und so gab ich schließlich auf.
Zu dieser Zeit geschahen mehrere Dinge, die mich seelisch aus der Bahn warfen. Der stärkste Faktor war der Tod meines Vaters, den ich jahrelang nicht verkraftet habe. Auch heute fällt es mir teilweise schwer, darüber nachzudenken. Ich hatte mir ungefähr in derselben Zeit bei einem Fahrradunfall einen Wirbel gebrochen und hatte die Aussicht, für den Rest meines Lebens mit Einschränkungen planen zu müssen, außerdem hatten meine damalige Freundin und ich uns frisch getrennt und es war keine von den ruhigen Trennungen, die zwar weh tun, aber sich richtig anfühlen. Sprich: Absolutes Gefühlschaos und die Aussicht auf eine ungewisse Zukunft, und es passierte das, was schon damals vor dem Umzug nach Essen passierte: Kurzschluss, Überschlagshandlung. Ich kündigte den Arbeits- und Mietvertrag und zog zu meinem damals besten Freund nach Berlin.
Kaum eingezogen wurde klar, dass die Wohnung für zwei Personen deutlich zu klein war. Da das Zusammenleben ansich aber gut zu funktionieren schien, beschlossen wir, eine WG mit zwei weiteren Menschen zu gründen. Gesagt, getan, es entstand eine WG, die über die Jahre eine hohe Mitbewohner-Fluktuation hatte und bei der ich am Ende der letzte verbliebene ursprüngliche Mieter war.
Während der WG-Zeit wurde klar, dass mit mir etwas nicht stimmte. Psychisch, seelisch, generell. Meine beste Freundin, die auf der anderen Seite Deutschlands lebte, nahm sich das Leben und meine emotionale Reaktion darauf blieb nahezu komplett aus. Die primäre Gefühlsregung war Unmut darüber, dass ich mir nun für den nächsten geplanten beruflichen Aufenthalt in der Region eine Alternativplanung für das dazwischenliegende Wochenende überlegen müsse. Nur ein Anflug von Trauer, der Verlust kam bei mir emotional nicht an. Mein nächster Weg war dann der zum Hausarzt, der eine mittelgradige Depression vermutete und mich zum Psychiater überwies, der dann exakt diese Diagnose stellte. Es folgten Jahre des Ausprobierens verschiedenster Antidepressiva, die ich allesamt körperlich nicht vertrug. Psychisch machten sie keinen Unterschied. An einen Therapieplatz zu kommen war schwierig und so landete ich kurzfristig zwar in einer Tagesklinik, die mich kurzzeitig stabilisierte, aber nach ein paar Monaten ging es mir wieder sehr schlecht.
Die Erkenntnis, die mich zum Facharzt trieb, war nur der Gipfel vieler Dinge, die mir in den Jahren davor, speziell in der Berliner Zeit, hätten auffallen können. Bereits in Bremen diagnostizierte ein Arzt Burnout, schwammig wie zu erwarten, und nahm mich für einige Wochen aus dem Arbeitsalltag. In Berlin hatte ich anfangs nur Schwierigkeiten, mich in Aufgaben einzuarbeiten und hatte keine weiteren Einschränkungen. Ich hatte einen großen Bekanntenkreis, mit dem ich viel unterwegs war und hatte Spaß daran, mich mit Menschen zu umgeben. Ich hatte acht Jahre lang in Bremen eine Großcommunity betreut, die meine damalige Partnerin und ich ins Leben gerufen hatten und die am Ende über 2000 Mitglieder zählte. Ich war den Umgang mit Menschen inzwischen gewohnt und hatte gelernt, wie ich mich zu verhalten hatte, um akzeptiert zu werden. Doch in Berlin ebbte der Menschenkontakt mit den Jahren immer mehr ab. Wo ich anfangs fast jedes Wochenende mit den WG-Mitgliedern, Freunden und Bekannten feiern war, Festivals und Konzerte nicht nur besuchte, sondern im Rahmen der gemeinsamen Band auch auftrat, zog ich mich mit der Zeit mehr und mehr zurück, verließ selten das Haus und trat aus der Band aus. Beruflich war ich seinerzeit als Penetrationstester tätig und mir fiel immer öfter auf, dass ich die anfallenden Berichte nur unter größter Überwindung schreiben konnte; am Ende schaffte ich es nicht einmal mehr, die Vorlage zu öffnen und den Namen des Kunden einzutragen. Die WG ging in die Brüche, da ich den Anforderungen der anderen Mitbewohner nicht mehr gerecht werden konnte und diese nicht damit umgehen konnten, dass ich aktuell nicht anders kann als mich zurückzuziehen. Ich zog aus, was (meinerseits unbeabsichtigt, aber nicht änderbar) das Ende des Mietvertrages für die ganze WG bedeutete.
An dieser Stelle war ich durch die Depressionen teilweise schon so gelähmt, dass ich es an manchen Tagen nicht mal mehr schaffte, das Bett zu verlassen. Der Arbeitgeber fing mich auf, war besorgt und gewährte mir die Freiräume, die ich brauchte, um trotzdem auf irgend eine Art weiter am Betriebsgeschehen teilzunehmen. Der Wechsel in andere Aufgabenbereiche und Abteilungen brachte kurzzeitig Erleichterung, aber auch das Verständnis und die Unterstützung von Vorgesetzten und Kollegen war überwältigend und nahm mir eine Menge meiner Ängste. Schließlich fand ich einen Therapeuten, der zwar nicht die erhoffte tiefenpsychologische Psychotherapie anbieten konnte, aber immerhin eine Gruppentherapie, die langsam aber sicher kleine Verbesserungen bewirkte und dies bis heute tut.
Der Weg zur Diagnose
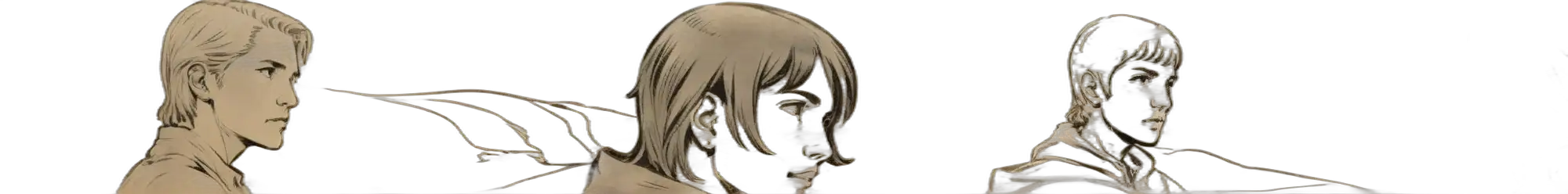
Kaum hatte ich die Therapie begonnen, kam (wie in meinem Leben üblich) überraschend der seit Jahren eingeschlafene Kontakt zu einer alten Freundin aus Bremer Zeiten wieder zustande. Man tauschte sich aus und plötzlich lag das Thema ADHS auf dem Tisch. Sie sei diagnostiziert worden und seitdem ginge es ihr deutlich besser. Es kristallisierte sich heraus, dass sie mit ganz ähnlichen Dingen zu kämpfen hatte, die ich selber nur allzu gut kannte, aber nie als abnormal wahrgenommen hatte, denn ich kannte es ja nicht anders. Ich begann, mich mit der Thematik auseinander zu setzen und erkannte extrem viele Paralleleln zu meiner eigenen Vergangenheit und Gegenwart. Ich lernte, dass ADHS nicht auf magische Weise im Erwachsenenalter verschwindet, dass es eine unbekannte Dunkelziffer an undiagnostizierten Personen gibt und dass man auch als Erwachsener versuchen kann, eine entsprechende Diagnose zu bekommen, wenn man die Vermutung hat, betroffen zu sein. Das brachte mich dazu, mit einem neuen Arbeitskollegen zu sprechen, der ebenfalls diagnostiziert wurde und relativ offen mit der Diagnose umging. Über ihn bekam ich die Adresse eines Dacharztes für ADHS und verwandte Themen und viele Informationen zum Umgang mit dieser Krankheit. Spannend war auch zu erleben, wie viele andere Kollegen sich nach kurzer Zeit ebenfalls als bereits diagnostiziert oder mit einem starken Verdacht “outeten”. Einige sind wie ich erst durch diesen gemeinsamen Austausch das erste Mal damit zum Arzt gegangen und einige sind inzwischen ebenfalls diagnostiziert.
Lange Rede, kurzer Sinn: Mein bisheriger Psychiater, bei dem ich wegen der Depressionsthematik in Behandlung war, schloss ADHS bei mir kategorisch aus. Ich bat ihn, dennoch die entsprechenden Testreihen mit mir durchzugehen, welche ich dann auf eigene Kosten auch absolvierte. Und die Ergebnisse waren aus meiner Sicht relativ deutlich, selbst als Laie konnte ich die starken Abweichungen von vielen Prüfpunkten sehen. Mein Psychiater allerdings beharrte auf seiner Meinung, und so wechselte ich zu dem Facharzt, den mein Kollege mir nannte.
Nun hatte ich schon drei Testergebnisse in der Hand, meine Zeugnisse sowie einen Bericht meiner Mutter angefordert, in der sie ihr Erleben meiner Kindheit beschrieb und reichte alles dort ein. Mein erster Termin bei dem Doc war relativ kurz. Ich erzählte, was mich zu ihm führte und welche Beobachtungen mich zu meinem Verdacht brachten, während er die Testergebnisse und die anderen Unterlagen überflog. Nach nur wenigen Minuten unterbrach er mich, ich brauche nicht weiterreden, das sei schon ein ziemlich eindeutiger Fall von ADHS und da müsse man (in Richtung meines bisherigen Psychiaters gesehen) schon mehr als beide Augen zugekniffen haben, um keinen entsprechenden Verdacht zu haben. Ich bekam Medikamente, die ich ausprobieren sollte und wurde für einen Monat zum Laborkaninchen in begrenzter Eigenregie. Beim nächsten Besuch bekam ich den selben Wirkstoff, allerdings in der für Erwachsene zugelssenen retardierten Form und auf Kassenrezept.
Das Thema Depressionen und ADHS könnte laut dem neuen Psychiater durchaus stark miteinander verknüpft sein. Wenn die Psyche permanent durch auf sie einprasselnde Eindrücke, die nicht intuitiv verarbeitet werden können, sondern immer volle Konzentration erfordern, überlastet wird, kann sie mit depressiven Symptomen reagieren. Das bewirkt schlussendlich, dass man sich diesen Eindrücken nicht mehr (oder nicht mehr so stark) aussetzt. Allerdings kommen durch so einen Rückzug auch neue Stressauslöser wie Selbstzweifel, Zukunftsängste oder Einsamkeit hinzu, die wieder die Depression verstärken. Mit Sicherheit ist damit ADHS zwar nicht der einzige Faktor, der meine Depressionen ausgelöst hat, aber einer der wichtigsten.
Leben nach der Diagnose
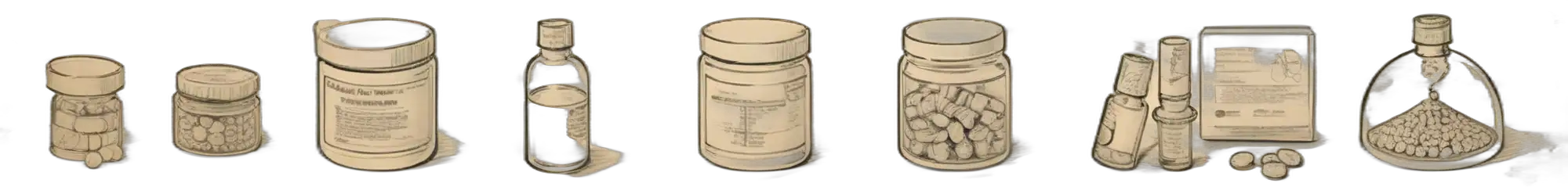
Durch die Diagnose hat sich in meinem Leben einiges geändert. Nicht einmal so sehr durch die Medikamente, auch wenn mir diese aktuell erlauben, mich den ganzen Tag auf meine Arbeit zu konzentrieren und andere Dinge besser auszublenden. Primär haben bei mir jedoch viele Denkprozesse eingesetzt, die ohne die Diagnose nur schwer oder gar nicht möglich gewesen wären.
So ist es alleine schon eine Erleichterung, durch diese Diagnose viele Dinge zu akzeptieren, die mich ausmachen. Sprunghafte Gedanken, wieso ticke ich da so anders als die meisten anderen? ADHS! Wieso kann ich nicht lange in einer Position sitzen und muss mich ständig bewegen, weil ich sonst das Gefühl habe, zu platzen? ADHS! Wieso kann ich mich auf Dinge, die mir Spaß machen und für die ich brenne, konzentrieren, aber auf andere nicht? Wieso sträubt sich mein Gehirn gegen Ordnung und sich wiederholende monotone Prozesse? ADHS! Wieso schlafe ich bei Frontalbeschallung (Schulungen, Unterricht, Konferenzen) ein, wenn ich mich nicht irgendwie ablenken kann oder mich das Thema wirklich extrem interessiert? ADHS! Ich lerne, dass ich mich nicht selber für solche Dinge hassen muss. Dass ich mich nicht dafür schämen muss, dass ich so bin. Dass ich es auch nicht ändern kann, selbst wenn ich will. Dass ich nicht faul bin, weil ich Dinge nicht schaffe, die vom Ding her easy sind, bis ich eine Deadline auf mich zurollen sehe und der entstehende Stress mich erst handlungsfähig macht. Ich muss mir keine Vorwürfe machen, wenn ich an unpassenden Stellen über etwas lache, das jemand gar nicht als Witz gemeint hat. Und ich habe das Recht, meinem Bedürfnis nach Ruhe und Rückzug nachzugehen, auch wenn ich erst zehn Minuten unter Leuten bin, dadurch aber schon komplett überlastet bin.
Bei einigen Dingen (Konzentrationsfähigkeit, Ablenkungen in gewissem Rahmen ausblenden) helfen die Tabletten sehr. Und während sie bei vielen Menschen, die sie gerade im Studium illegal als Aufputsch- bzw. Konzentrationssteigerungsmittel nehmen eine sehr direkt wahrnehmbare Wirkung zu haben scheinen, merke ich davon tatsächlich eher wenig. Ich habe generell bei Medikamenten und Drogen, die in den Dopaminhaushalt eingreifen, beobachtet, dass diese kaum eine Wirkung bei mir haben. Auch in hohen Dosen beobachte ich bei mir nicht annähernd die Reaktion, die sie bei “neurotypischen” Personen haben. Generell beobachte ich bei mir selbst ein unglaublich geringes Suchtpotenzial. Ich habe in meinem Leben teils jahrelang stark geraucht, getrunken und gekifft. Und ich habe immer von einem Tag auf den anderen aufhören können, ohne dass ich großartige Entzugserscheinungen hatte. Am ehesten körperliche, gerade bei Alkohol, aber darüber hinaus hatte ich nie dieses Gefühl, wieder anfangen zu müssen oder den Entzug (sofern spürbar) abzubrechen. Es gab selten ein “ich brauche das jetzt”-Gefühl. Da ADHS nach aktueller Erkenntnis mit einen Dopaminmangel im Hirn einhergeht, verschiedene Drogen Dopaminausschüttung veranlassen und diese bei mir möglicherweise gestört ist, könnte dies ein möglicher Erklärungsansatz sein. Da es aber (Stand heute) schwierig bis unmöglich ist, einen Dopaminmangel direkt nachzuweisen, bleibt es eine Theorie, mit der ich aber ganz gut leben kann.
Kurioserweise könnte ein Dopaminmangel im Hirn, der indirekt meine Depressionen durch ADHS-typische Überlastung begünstigt hat, auch erklären, wieso ich die Antidepressiva nicht vertragen habe. Diese erhöhen auf verschiedenen Wegen auch die Konzentration anderer Neurotransmitter im Hirn, unter anderem Serotonin. Die Medikamente, die ich bekam, waren primär SSRIs, also selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer. Wenn nun mein Serotoninspiegel ganz normal war (auch hier: Ein Nachweis ist im lebenden Hirngewebe schwierig) reagiert der Körper auf eine Erhöhung der Pegel mit Vergiftungserscheinungen. Schwindel, Übelkeit, Schweißausbrüche, Gleichgewichtsstörungen, Koordinationsstörungen, Herzrasen und Tinnitus waren meine Reaktionen auf nahezu jedes Medikament, das den Serotoninspiegel beeinflusst hat, bei manchen ausgeprägter und bei manchen weniger, aber generell immer die selbe Reaktion. Die Ärzte taten es als “Das sind normale Gewöhnungserscheinungen während des Einschleichens der Medikamente, da müssen Sie durch” ab. Die Symptome waren allerdings auch nach Monaten noch dieselben, während die erhoffte Wirkung ausblieb.
Generell gesprochen bin ich unglaublich froh, den Weg der ADHS-Diagnostik beschritten zu haben und mit einer entsprechenden Diagnose herausgekommen zu sein. Auch wenn viele Frage noch offen sind und ich erst einmal lernen muss, mit den Implikationen bestmöglich zu leben, habe ich alleine durch das Wissen, was warum so ist, wie es ist, ein mächtiges Werkzeug an der Hand. Ein Werkzeug, mit dem ich Dinge verändern kann, die mich kaputt machen und mit dem ich andere Dinge ausfindig machen kann, die mich beeinflussen, die ich aber nicht ändern kann. So kann ich gezielt nach Wegen suchen, meine durch ADHS entstandenen Einschränkungen und ungesunden Verhaltensweisen Stück für Stück zu ändern.
ADHS wird mich mein Leben lang begleiten. Die Depressionen vielleicht auch. Aber beides kann ich soweit in den Griff bekommen, dass ich damit leben und die positiven Aspekte (zumindest bei ADHS) für mich nutzen kann.
Gedanken und Erkenntnisse
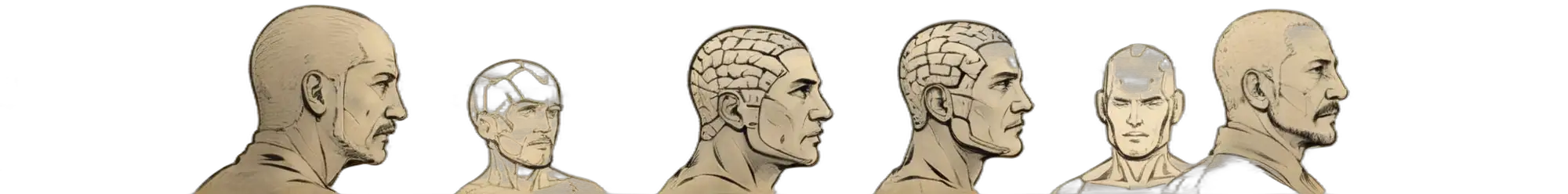
Arbeitstechnisches / Kommunikation
Ein Freund fragte mich kurz nach Veröffentlichung dieser Rubrik, ob ich es für eine gute Idee halte, derartige Informationen über mich öffentlich verfügbar zu machen. Auf Rückfrage erklärte er, ich mache mich dadurch zum einen angreifbar, zum anderen senke ich aber auch meinen Wert am Arbeitsmarkt bzw. gebe möglichen zukünftigen Arbeitgebern Informationen an die Hand, aufgrund derer sie mich nicht einstellen könnten.
Ansich sind das nachvollziehbare Gedanken. Natürlich könnte jemand Informationen, die ich hier über mich preisgebe, gegen mich verwenden. Theoretisch jedenfalls. Praktisch würde das vermutlich nur gelingen, wenn ich mit mir und meinem Zustand im Unreinen wäre. Bin ich allerdings nicht. :) Womit soll man mir schaden wollen? “Ich sag Deinem Arbeitgeber, dass Du krank bist”? Weiß der schon seit Jahren und unterstützt mich auf allen Ebenen. Meine Familie ebenso. Auch der Freundeskreis weiß Bescheid. Direkt angreifbar bin ich durch das Ganze auch nicht, sonst hätte ich vermutlich schon größte Schwierigkeiten gehabt, über das Ganze zu schreiben.
Und die Sache mit zukünftigen Arbeitgebern (die das hier potenziell auch lesen)? Das ist für mich die unkritischste bzw. einfachste Facette der Fragestellung. Ich handhabe das als automatisches Aussieben. Wenn ein potenzieller zukünftiger Arbeitgeber von meiner Krankheit erfährt und daraufhin kein Bewerbungsgespräch anbietet: So be it, das wäre tatsächlich auch kein Arbeitgeber, mit dem ich glücklich werden würde. Meinerseits verstehe ich meine Offenheit dem Thema gegenüber auch als Fairness denen gegenüber, die mit mir zusammenarbeiten wollen, denn so wissen sie, was auf sie zukommen würde. So haben beide Seiten die Chance, die Karten offen auf den Tisch zu legen und auf Augenhöhe zu verhandeln. Wenn dadurch direkt ein hoher Prozentsatz an Angeboten wegfallen würde, soll mir das recht sein. Gespräche in dieser Richtung wären Zeitverschwendung für beide Seiten - der verbleibende Rest ist der, für den ich mich interessiere.
Gründe für die Offenheit
Auch diese Frage höre ich von Zeit zu Zeit. Die Frage, wieso ich sowohl dem Arbeitgeber als auch der Öffentlichkeit gegenüber offen über ADHS und Depressionen rede. Auch da kommt oft das Argument “Angreifbarkeit” und “das geht doch keinen was an”.
Spätestens bei letzterem Punkt möchte ich widersprechen: mental issues gehen uns als Gesellschaft sehr wohl etwas an. Dass diese traditionell kleingeredet, ganz verschwiegen oder mit Alkohol seitens der Betroffenen im stillen Kämmerlein behoben werden ist Teil eines ganz massiven Problems. Wenn ich in bestimmten Kreisen herumfrage, mit denen ich viel zu tun habe, und quasi von jeder zweiten Person zu hören bekomme “Ja, mit Depressionen/Burnout hatte ich auch schon selber zu tun”, geht das jeden etwas an. Auch Menschen mit ADHS-Verdacht oder -Diagnosen, die erst im Erwachsenenalter zum Thema wurden, kenne ich unglaublich viele - vollkommen unabhängig von meiner eigenen Diagnose und den Kreisen, die das gerade zieht.
Genauer gesagt haben wir zwei Probleme, wegen denen ich mit der Thematik nicht stumm bleibe: Offenbar begünstigt unsere aktuelle Gesellschaft die Entstehung von psychischen Erkrankungen, außerdem werden diese meist totgeschwiegen (“Was sollen denn die anderen denken?!) und die Symptome werden im Zweifel nur noch schlimmer. Wir brauchen mehr Psychologen, die sich auskennen und auch kurz- und mittelfristige Termine anbieten können. Wir brauchen mehr Forschung zu den Ursachen. Wir brauchen mehr Sichtbarkeit, Rückhalt und Verständnis in der Bevölkerung und bei Arbeitgebern.
Gerade ADHS ist keine einseitige Medaille. Sicher, einige Aspekte des Lebens werden dadurch erschwert und wenn es durch den Überlast-Marathon zu weiteren Erkrankungen wie Depressionen kommt, ist das kaum etwas, aus dem man etwas Positives ziehen kann. Auf der anderen Seite erlebe ich ADHS-Betroffene als hyperkreativ, unglaublich leistungsfähig wenn man ihnen Aufgaben gibt, die sie interessieren und oft auch aufopfernd hilfsbereit. Wenn Gesellschaft und Arbeitgeber es schaffen, dieses Potenzial zu nutzen, ohne die negativen Aspekte zu befeuern, hätten alle etwas davon.
Von toten Linien und roten Fäden
Für die meisten Menschen sind Deadlines kein großes Problem. Man kümmert sich rechtzeitig und hat die Deadline im Blick, kann also dafür sorgen, dass Aufgaben rechtzeitig vorher beendet sind, um die zeitlichen Vorgaben einzuhalten.
Für mich sind Deadlines eine besondere Art von Endgegnern. Sie tauchen vollkommen überraschend auf und schlagen gnadenlos zu. Sicher, der eine oder andere wird jetzt vollkommen zu Recht anmerken, dass die Deadline ja vorher kommuniziert, angekündigt und bestimmt auch im Kalender vermerkt war. Kurioserweise ist mir das auch jederzeit bewusst, es ist nicht so, dass ich von der Deadline nichts weiß. Es ist nur so, dass sie halt in der Zukunft liegt, und die ist etwas, das mein Bewusstsein nicht als unaufhörlich auf mich zurollende Entität wahrnimmt.
Das Problem ist, dass viele ADHS-Betroffene ein fehlendes Gefühl für dieses Ding namens “Zeit” haben. Zeit ist schon für Physiker etwas, das man schwer beschreiben kann, denn es lässt sich zwar messen, aber nicht so richtig fassen. Zeit vergeht unterschiedlich schnell für Objekte, die sich unterschiedlich schnell bewegen - aber eigentlich nur aus der Perspektive des jeweils anderen bzw. eines Beobachters. Die Zeit als Komponente der Raumzeit ist ein relativ junges Konzept. Und dass Zeit einfach das Wahrnehmen des Bedürfnisses aller Dinge ist, sich in Richtung maximaler Entropie zu entwickeln… naja, das ist schon arg abstrakt. Da ist es schon praktisch, dass die meisten Menschen ein Gefühl für Zeit entwickelt haben und dass wir über Messgeräte verfügen, die den Ablauf der Zeit wenigstens im selben Bezugsrahmen halbwegs genau bestimmen können.
Irgendwann Anfang 2024 las ich das erste mal davon, dass meine Mitleidenden offenbar primär im “Jetzt” leben. Planung ist schwierig und auch Erinnerungen einem bestimmten Zeitpunkt zuzuordnen fällt schwer. Wie so oft erkannte ich mich in dieser Beschreibung auffällig gut wieder. Frag’ mich, was ich am Vorabend gegessen habe: Ich habe größte Schwierigkeiten, die Frage zuverlässig zu beantworten. Nicht, weil ich nicht wüsste, was ich so in letzter Zeit zu mir genommen habe, in der Regel merke ich mir das schon. Aber ich kann nicht zuordnen, ob es nun die Puffreis-Cracker waren, die Nudelsuppe oder der Müsliriegel. In den meisten Fällen kann ich so etwas nur anhand der Umstände rekonstruieren: Müsliriegel esse ich eher morgens oder mittags im Büro, Nudelsuppe mittags im Büro oder abends zu Hause, Reiscracker eher nur abends zu Hause. Und so habe ich schließlich eine ausreichend plausible Reihenfolge, dass ich behaupten kann: “Vermutlich Puffreis, glaube ich.”
In diesem Kontext fällt oft der Begriff “time blindness” und dieses Unvermögen, Zeit zuverlässig als konstant fließendes Konstrukt wahrzunehmen, sorgt nicht nur beim Erinnern der letzten Mahlzeiten für Ungemach. Auch Deadlines werden damit zum abstrakten Begriff, da sie erst dann als relevant wahrgenommen werden, wenn sie im “Jetzt” ankommen, oder zumindest beim Blick auf den Kalender der aktuellen Woche sichtbar werden. Bei mir persönlich ist es zudem so, dass ich, selbst wenn ich von einer Deadline weiß, die gerade noch mit vertretbarem Aufwand zu schaffen ist, dadurch in keinen Reaktionsmodus komme. Ich weiß, dass ich JETZT anfangen müsste, Dinge zu tun, aber der Impuls im Kopf, der darauf Taten folgen lassen sollte, liegt still in einer Ecke und döst vor sich hin. Warum das so ist? Vermutlich wie bei so vielen Dingen ein Dopaminmangel.
Das Spannende an Dopamin ist für mich, dass es, sobald ich eine Tätigkeit angefangen habe, offenbar in ausreichenden Mengen produziert wird. Habe ich diesen inneren Mt. Everest überwunden, der mich daran hindert, mit einer Tätigkeit zu beginnen, gehen mir die meisten Tätigkeiten leicht von der Hand. Oft verliere ich zwar nach einiger Zeit wieder die Konzentration oder das Interesse, aber das ist mit den richtigen Medikamenten ein lösbares Problem.
Der innere Mt. Everest ist für mich nur schwer zu bezwingen. Es gibt drei Möglichkeiten, wie ich es aktuell schaffe:
- Die Deadline steht vor der Tür und die Panik, es nicht zu schaffen, trägt mich über diesen Berg; meist folgt durchgehende Nachtarbeit, um es noch rechtzeitig zu schaffen.
- Medikamente helfen mir, den Berg etwas abzutragen, bevor ich ihn besteige. Klappt nicht immer, aber wenn, komme ich gut voran.
- Zeit. Gerade das Konstrukt, das mir solche Probleme macht, löst sie manchmal auch, denn irgendwann überkommt es mich doch und ich laufe einfach um den Berg herum. Bis das passiert können aber Wochen und Monate vergehen, daher ist das für Deadlines eher keine Lösung.
Bevor ich Medikamente bekam, vor meiner Diagnose, hatte ich keine Erklärung dafür, wieso ich nicht in der Lage war, Deadlines einzuplanen und zu berücksichtigen wie meine Kollegen. Wieso meine Hilfsmittel alle versagten und nur die kurz bestehende Deadline mich in einen Zustand brachte, der es mir mit massivem Stress und Schuldgefühlen erlaubte, die meisten Deadlines dennoch einzuhalten - zu Lasen meines Körpers und des seelischen Wohlbefindens. Das zieht sich wie eine rote Linie (man beachte meine geschickte Referenz auf den zweiten Teil der Headline) durch mein ganzes Leben, mal mehr, mal weniger intensiv. Heute weiß ich, dass das weder meine Schuld ist, noch dass ich mich dafür schämen muss. Ich habe zudem Werkzeuge in die Hand bekommen, mit denen ich diese Situation besser in den Griff bekomme.